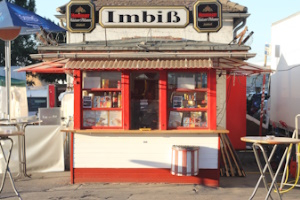Partner
Uraufführung von Furor im Schauspiel
Die Raserei des Volkes
Ein Stück, das aktueller nicht sein könnte: Anselm Weber holt in "Furor" den Wutbürger auf die Bühne. Auf engstem Raum wird dieser mit seinem Feindbild konfrontiert, dem etablierten Politiker. Eine höchst brisante Versuchsanordnung.
Eine schmale graue Couch, ein grauer Sessel, ein weiß lackierter Pressspantisch, ein beiger Teppich – das ist die gesamte karge Einrichtung des Raums, in dem „Furor“ am Freitagabend uraufgeführt wurde. Die Darsteller werden ihn in knapp zwei Stunden nicht verlassen. Im Hintergrund die trostlose Fassade eines Plattenbaus, wie er in jeder deutschen Großstadt zu finden ist. Im Mittelpunkt des Stücks: Ministerialdirigent und Oberbürgermeister-Kandidat Heiko Braubach (Dietmar Bär), Altenpflegerin Nele (Katharina Linder) und Paketbote Jerome (Fridolin Sandmeyer).
Der Plot ist schnell erzählt. Braubach hat einen jungen Mann überfahren, den drogenabhängigen Sohn von Nele. Der Junge überlebt den Unfall zwar, bekommt jedoch ein Bein amputiert und wird vermutlich den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sein. Braubach wird von jeder Schuld freigesprochen, er fühlt sich dennoch verpflichtet, der verzweifelten Mutter seine Hilfe anzubieten. In das Gespräch platzt irgendwann Jerome, Neles Neffe, der den mitten im Wahlkampf steckenden Braubach erpressen will. Was simpel klingt, entfaltet sich im Verlauf des Stücks zu einer hochkomplexen Geschichte, wie sie aktueller und deprimierender kaum sein könnte.
In der Enge des kleinen Raums, der mit jeder Minute, die verstreicht, noch weiter zu schrumpfen scheint, prallen die Sorgen dreier Menschen aufeinander, deren Lebensrealitäten kaum unterschiedlicher sein könnten. Braubach scheint vor allem sein Gewissen beruhigen zu wollen. Der junge Mann, den er überfahren hat, soll plötzlich, wie aus dem Nichts, vor sein Auto gesprungen sein. Sämtliche Gutachten fielen zugunsten des Politikers aus. Die Presse ist sich sicher, dass das Unfallopfer ein krimineller Junkie ist.
Der von Tatort-Kommissar Dietmar Bär gespielte Braubach wirkt vollkommen deplatziert in dem kargen Raum, der angefüllt ist mit den Ängsten der verzweifelten Mutter. Während der Politiker nach Worten sucht, um sein Mitgefühl auszudrücken, treibt Nele vor allem um, wie sie zukünftig die Bürde eines behinderten Sohnes alleine stemmen soll. Die Plattenbau-Wohnung ist nicht barrierefrei und das Geld knapp. Schnell ist die Altenpflegerin bereit, Braubach zu glauben und Vertrauen zu schenken, als der in routinierter Politiker-Manier Lösungsvorschläge unterbreitet.
Das Gefühl, die Verantwortung zumindest teilweise abgeben zu können, scheint die Mutter zu beruhigen. Kurzzeitig scheint sich die Situation zu entspannen, doch dann tritt Jerome auf, Neles Neffe. Und Jerome ist wütend. Wütend auf den Politiker, der seinen Cousin in den Rollstuhl gebracht hat und dennoch straffrei davonkommt, wütend auf die Presse, die die Unbedarftheit seiner Tante für eine reißerische Story ausgeschlachtet hat, wütend auf das System, in dem er, der Paketbote, niemals die Möglichkeit erhalten wird, die Enge dieses Plattenbaus zu verlassen.
Fridolin Sandmeyer ist grandios in dieser Rolle. Er schreit die Wut des Ausgegrenzten heraus, entlarvt den Politiker als jemanden, der zwar von sich behauptet, Menschen wie Jerome zu verstehen, eigentlich aber keinerlei Berührungspunkte mit dessen Leben hat. Als Zuschauer spürt man förmlich die Rückenschmerzen des Paketboten, der Stunde um Stunde, Tag für Tag, schuften muss. Man fühlt den knurrenden Magen dieses jungen Mannes, der während seiner zehn-Stunden-Schichten keine Zeit für eine Pause findet. Man begreift seine Wut auf das System, das nicht nur auf dieser Bühne im Schauspiel versagt hat.
Und während Sandmeyer so wunderbar diesen verletzten 29-Jährigen spielt, reift in einem selbst das Unbehagen. Denn das, was dort in diesem kleinen, kargen Wohnzimmer stattfindet, sich immer weiter zuspitzt und irgendwann in einem dramatischen Finale überkocht, ist das, was aktuell tagtäglich in unserer Mitte stattfindet. Anselm Weber präsentiert dem Zuschauer mit „Furor“ eine gesellschaftliche Diagnose, wie sie zutreffender kaum sein könnte. Auf der Bühne keimt das neofaschistische Saatgut, das den Rechtspopulisten unserer Zeit Nahrung bietet. Man möchte einschreiten, die Menschen, die einfach keine Verständigungsgrundlage finden wollen, packen und schütteln – und bleibt doch nur still, mit diesem fürchterlichen Gefühl der Enge in der Brust, unbeteiligt am Rande stehend. Schweigend, betrachtend, aber niemals handelnd.
Der Plot ist schnell erzählt. Braubach hat einen jungen Mann überfahren, den drogenabhängigen Sohn von Nele. Der Junge überlebt den Unfall zwar, bekommt jedoch ein Bein amputiert und wird vermutlich den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sein. Braubach wird von jeder Schuld freigesprochen, er fühlt sich dennoch verpflichtet, der verzweifelten Mutter seine Hilfe anzubieten. In das Gespräch platzt irgendwann Jerome, Neles Neffe, der den mitten im Wahlkampf steckenden Braubach erpressen will. Was simpel klingt, entfaltet sich im Verlauf des Stücks zu einer hochkomplexen Geschichte, wie sie aktueller und deprimierender kaum sein könnte.
In der Enge des kleinen Raums, der mit jeder Minute, die verstreicht, noch weiter zu schrumpfen scheint, prallen die Sorgen dreier Menschen aufeinander, deren Lebensrealitäten kaum unterschiedlicher sein könnten. Braubach scheint vor allem sein Gewissen beruhigen zu wollen. Der junge Mann, den er überfahren hat, soll plötzlich, wie aus dem Nichts, vor sein Auto gesprungen sein. Sämtliche Gutachten fielen zugunsten des Politikers aus. Die Presse ist sich sicher, dass das Unfallopfer ein krimineller Junkie ist.
Der von Tatort-Kommissar Dietmar Bär gespielte Braubach wirkt vollkommen deplatziert in dem kargen Raum, der angefüllt ist mit den Ängsten der verzweifelten Mutter. Während der Politiker nach Worten sucht, um sein Mitgefühl auszudrücken, treibt Nele vor allem um, wie sie zukünftig die Bürde eines behinderten Sohnes alleine stemmen soll. Die Plattenbau-Wohnung ist nicht barrierefrei und das Geld knapp. Schnell ist die Altenpflegerin bereit, Braubach zu glauben und Vertrauen zu schenken, als der in routinierter Politiker-Manier Lösungsvorschläge unterbreitet.
Das Gefühl, die Verantwortung zumindest teilweise abgeben zu können, scheint die Mutter zu beruhigen. Kurzzeitig scheint sich die Situation zu entspannen, doch dann tritt Jerome auf, Neles Neffe. Und Jerome ist wütend. Wütend auf den Politiker, der seinen Cousin in den Rollstuhl gebracht hat und dennoch straffrei davonkommt, wütend auf die Presse, die die Unbedarftheit seiner Tante für eine reißerische Story ausgeschlachtet hat, wütend auf das System, in dem er, der Paketbote, niemals die Möglichkeit erhalten wird, die Enge dieses Plattenbaus zu verlassen.
Fridolin Sandmeyer ist grandios in dieser Rolle. Er schreit die Wut des Ausgegrenzten heraus, entlarvt den Politiker als jemanden, der zwar von sich behauptet, Menschen wie Jerome zu verstehen, eigentlich aber keinerlei Berührungspunkte mit dessen Leben hat. Als Zuschauer spürt man förmlich die Rückenschmerzen des Paketboten, der Stunde um Stunde, Tag für Tag, schuften muss. Man fühlt den knurrenden Magen dieses jungen Mannes, der während seiner zehn-Stunden-Schichten keine Zeit für eine Pause findet. Man begreift seine Wut auf das System, das nicht nur auf dieser Bühne im Schauspiel versagt hat.
Und während Sandmeyer so wunderbar diesen verletzten 29-Jährigen spielt, reift in einem selbst das Unbehagen. Denn das, was dort in diesem kleinen, kargen Wohnzimmer stattfindet, sich immer weiter zuspitzt und irgendwann in einem dramatischen Finale überkocht, ist das, was aktuell tagtäglich in unserer Mitte stattfindet. Anselm Weber präsentiert dem Zuschauer mit „Furor“ eine gesellschaftliche Diagnose, wie sie zutreffender kaum sein könnte. Auf der Bühne keimt das neofaschistische Saatgut, das den Rechtspopulisten unserer Zeit Nahrung bietet. Man möchte einschreiten, die Menschen, die einfach keine Verständigungsgrundlage finden wollen, packen und schütteln – und bleibt doch nur still, mit diesem fürchterlichen Gefühl der Enge in der Brust, unbeteiligt am Rande stehend. Schweigend, betrachtend, aber niemals handelnd.
5. November 2018, 11.04 Uhr
Ronja Merkel

Ronja Merkel
Jahrgang 1989, Kunsthistorikerin, von Mai 2014 bis Oktober 2015 leitende Kunstredakteurin des JOURNAL FRANKFURT, von September 2018 bis Juni 2021 Chefredakteurin. – Mehr von Ronja
Merkel >>
Mehr Nachrichten aus dem Ressort Kultur

Frankfurt-Ostend
Jens Düppe und Simin Tander in der Romanfabrik
Im vergangenen Dezember war Jens Düppe mit seinem Solo-Programm „ego_D“ im Frankfurter Salon zu Gast. Am 30. November bringt er mit Simin Tander eine ganz besondere Sängerin mit in die Romanfabrik.
Text: Detlef Kinsler / Foto: Simin Tander & Jens Düppe © Gerhard Richter
KulturMeistgelesen
- Kunstausstellung in EschbornGesammelte Fotografien der Deutschen Börse
- Lilian Thuram in FrankfurtFranzösische Fußballlegende spricht über Rassismus
- Schirn Kunsthalle FrankfurtDie Kräfte neu vermessen
- Literatur in FrankfurtNeue Lesebühne im Café Mutz
- Filmfestival in WiesbadenExground Filmfest legt Fokus auf Flucht und Migration
20. November 2024
Journal Tagestipps
Freie Stellen